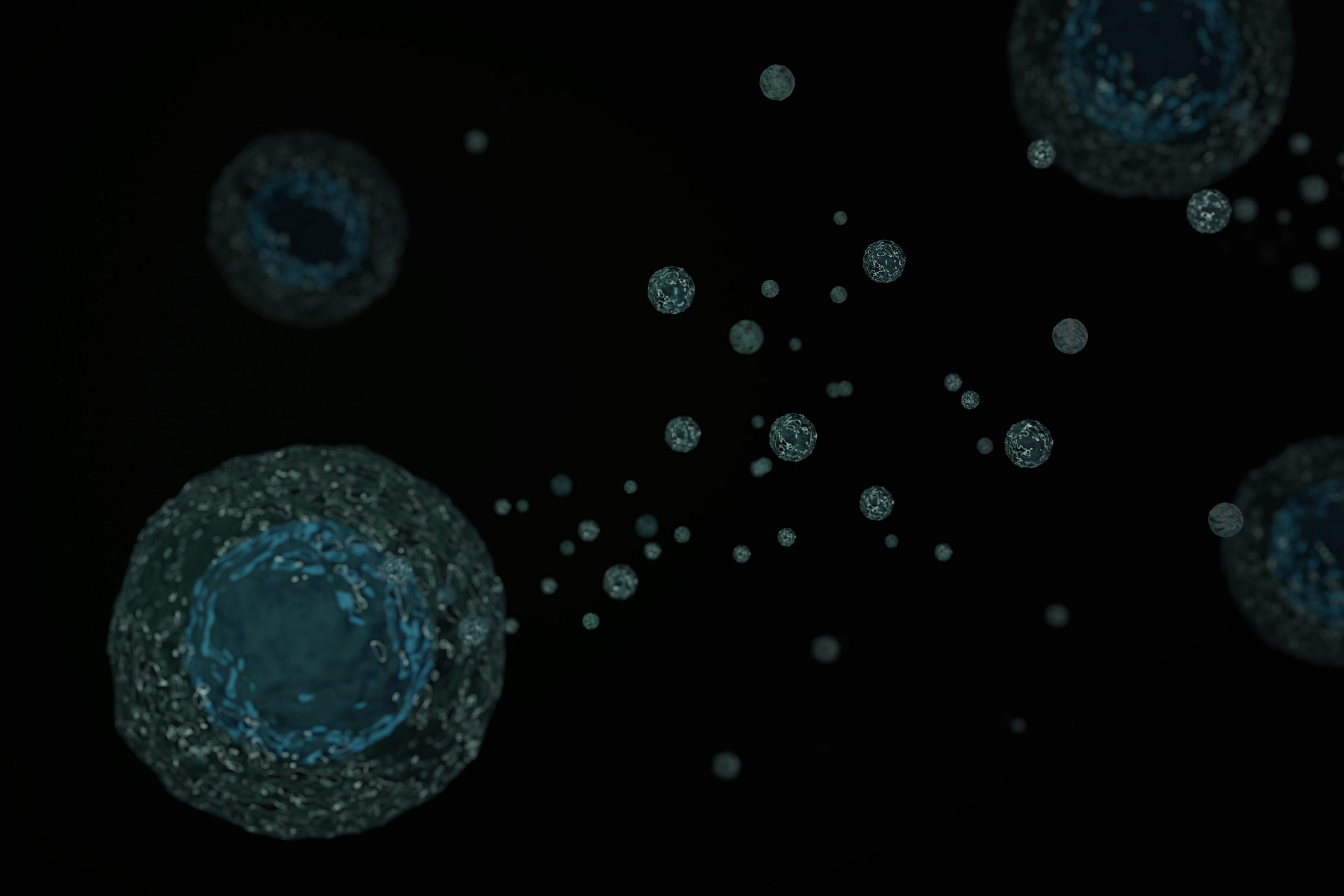
(Wien, 28-10-2024) Im Rahmen einer internationalen Studie unter Leitung der MedUni Wien wurden die potenziellen Vorteile von extrazellulären Vesikeln (EVs) aus dem probiotischen Bakterium Escherichia coli A0 34/86 (EcO83) bei therapeutischen Anwendungen untersucht. Die Forscher:innen zeigen, dass EVs eine vielversprechende Alternative zu lebenden probiotischen Bakterien darstellen könnten, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit und Wirksamkeit. Die Studienergebnisse wurden kürzlich im „Journal of Extracellular Vesicles“ veröffentlicht.
Probiotische Bakterien sind lebende Mikroorganismen, die, wenn sie in ausreichenden Mengen verabreicht werden, gesundheitliche Vorteile bieten können. Sie spielen eine wichtige Rolle in der Erhaltung der Gesundheit des Magen-Darm-Trakts und können das Immunsystem unterstützen. Probiotika werden häufig zur Vorbeugung von Infektionen und Durchfallerkrankungen eingesetzt, insbesondere bei Neugeborenen. Trotz ihrer positiven Effekte bestehen jedoch Bedenken hinsichtlich der Verwendung lebender Probiotika, insbesondere bei immungeschwächten Patient:innen. Hier kommen die sogenannten postbiotischen Therapien ins Spiel, die auf der Verwendung nicht lebender Mikroben beruhen, die immunmodulatorische Wirkungen haben und ähnliche gesundheitliche Vorteile bieten wie lebende Probiotika. Diese Therapien nutzen die bioaktiven Komponenten, die von Bakterien produziert werden, einschließlich Proteine, Lipide und Nukleinsäuren, um die Immunantwort des Wirts zu modulieren, ohne die Risiken lebender Mikroben zu entfalten.
Die in dieser Studie von einem Team um Agnieszka Razim und Irma Schabussova (Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie, Institut für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin, MedUni Wien) untersuchten extrazellulären Vesikel von EcO83 könnten durch ihre Fähigkeit, Immunreaktionen auszulösen, eine neue Klasse von postbiotischen Therapeutika darstellen. Die EVs wurden isoliert und gemäß den Minimal Information for Studies of Extracellular Vesicles (MISEV)-Richtlinien charakterisiert. Diese Richtlinien sorgen für die Transparenz und Reproduzierbarkeit in der Forschung zu EVs und legen fest, welche Informationen in Studien bereitgestellt werden sollten. Extrazelluläre Vehikel sind membranumhüllte Strukturen, die von Zellen abgeschnürt werden und biologisch aktive Moleküle wie Proteine, Lipide und Nukleinsäuren enthalten können. Sie sind in der Lage, mit anderen Zellen zu interagieren und deren Funktion zu beeinflussen.
In vitro- und in vivo-Experimente zeigten, dass die EVs von EcO83 eine Wechselwirkung mit humanen Nasenepithelzellen eingehen und eine Immunantwort in der Nasenschleimhaut sowie eine Rekrutierung von Entzündungszellen in die Lunge auslösen. Die Mechanismen dieser Interaktionen umfassen die Aktivierung eines bestimmten Signalwegs, der eine Schlüsselrolle in der Regulierung von Entzündungsreaktionen spielt, sowie die Produktion von Stickstoffmonoxid (NO), einem Molekül, das wichtige Funktionen im Immunsystem hat.
„Die Ergebnisse unserer Studie könnten die Entwicklung von innovativen Therapien vorantreiben, die sich auf die Behandlung und Prävention von allergischen Reaktionen und anderen entzündlichen Erkrankungen konzentrieren“, betont Studienleiterin Irma Schabussova. Die Verwendung von EVs als postbiotische Therapeutika könnte die Sicherheit und Effektivität von Behandlungen erhöhen, da sie die Risiken lebender Probiotika minimieren und gleichzeitig deren immunmodulatorische Eigenschaften beibehalten. Weitere Forschungen sind erforderlich, um das volle therapeutische Potenzial von EcO83-EVs zu bewerten.
Publikation: Journal of Extracellular Vesicles
Bacterial extracellular vesicles as intranasal postbiotics: Detailed characterization and interaction with airway cells.
Agnieszka Razim, Agnieszka Zabłocka, Anna Schmid, Michael Thaler, Viktor Černý, Tamara Weinmayer, Bradley Whitehead, Anke Martens, Magdalena Skalska, Mattia Morandi, Katy Schmidt, Magdalena E. Wysmołek, Akos Végvári, Dagmar Srutkova, Martin Schwarzer, Lukas Neuninger, Peter Nejsum, Jiri Hrdý, Johan Palmfeldt, Marco Brucale, Francesco Valle, Sabina Górska, Lukas Wisgrill, Aleksandra Inic-Kanada, Ursula Wiedermann, Irma Schabussova.
https://doi.org/10.1002/jev2.70004